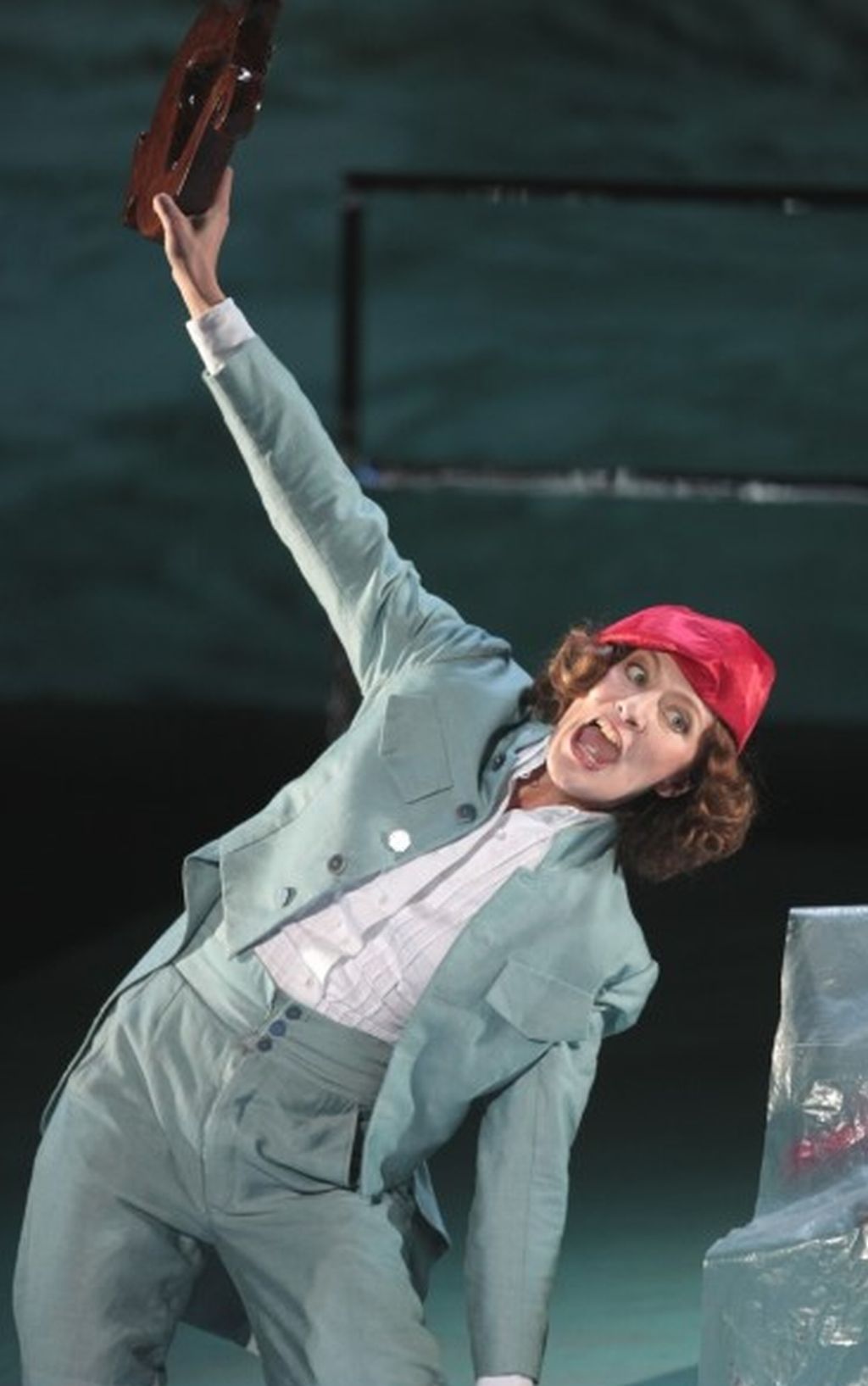|
|
|
Fazit:
Lissabon ist immer eine Reise wert, und wenn man noch dazu einen
so schönen »Hoffmann« geboten bekommt, noch viel
mehr. Ein hervorragendes Orchester, das mit deutscher Präzision,
atlantischer Dynamik und romanischer Spritzigkeit spielte. Außer
einem einzigen schwachen Einsatz eines Hornisten (was sonst
häufiger vorkommt) hörte ich während der ganzen
Vorstellung keinen falschen Ton. Chor und Orchester befanden sich
immer im Gleichtakt. Und das, obwohl der Chor den Dirigenten oft
nicht sehen konnte.
Ein
diszipliniertes und verständiges Publikum, das verhalten,
aber gut mitging und sich zum Schluss steigerte. Eine
einfallsreiche und dynamische Regie, die es nicht nötig
hatte, das Publikum mit aufgesetzten Gags zu unterhalten.
Christian von Götz bot mit seinem Team eine einfühlsame
und teilweise kreative Interpretation des »Hoffmann«.
Stimmlich
gab es nicht immer erste Sahne, aber auch Lichtblicke wie die
Antonia samt Vater und den Widersacher. Respekt vor dem neu
eingesprungenen Hoffmann. Sehr ansprechend auch das farblich und
gestalterisch gelungene Bühnenbild Gabriele Jaeneckes. Die
Bühnentechnik funktionierte perfekt. Die Beleuchtung, sonst
häufig vernachlässigt, war kongenial, wie auch die
Kostüme.
|
|
|
|
Wie
man den Regisseur eines so gelungenen »Hoffmann« bei
der Premiere ausbuhen und in der örtlichen Presse
runtermachen kann, ist mir ein Rätsel. Möglicherweise
waren es antideutsche Ressentiments von Ewiggestrigen, da das
Teatro de São Carlos zur Zeit einen deutschen
künstlerischen Leiter hat, dieser »Hoffmann« von
Deutschen inszeniert, musikalisch geleitet, szenographisch
gestaltet, von einem Österreicher beleuchtet und von
mehreren Deutschen gesungen wurde. Eine andere mögliche
Erklärung könnte sein, dass der von Götz'sche
»Hoffmann« keine superästhetisch-geschniegelte
Oper bot, wie das vielleicht ein Teil des Publikums oder der
Kritik erwartete. Ich mag solche aufgebrezelten und
durchgestylten Salon-»Hoffmänner« nicht, in
denen ein Hoffmann im Frack mit Seidenhemd und weißer
Fliege als Grandseigneur auftritt. Das entspricht nicht dem Image
des scheiternden Poeten. Christian von Götz' Hoffmann
stammte aus dem existenzialistischen Intellektuellen-Milieu und
war ein Borderline-Fall, was auch die Irrenhausszenerie
andeutete. Sein Hoffmann war ein labiler, sensibler und irrender
Poet, mit dem ich mich gut identifizieren konnte. Das Publikum
bei der von mir besuchten Aufführung jedenfalls zeigte sich
sehr angetan von diesem »Hoffmann«. Meine Begleiter
und ich waren es auch.
|
|
|
|
Lissabon
liegt ja nicht gerade um die Ecke, ist aber mein Favorit unter
den Metropolen, die ich kenne. Die Stadt ist elegant, aber nicht
spektakulär, alt und fortschrittlich zugleich, und sie hat
ein wunderschönes Opernhaus, das Teatro de São
Carlos, das in die Hügellanschaft Lissabons hineingebaut
wurde. Zum Theater fährt man natürlich stilgerecht mit
der legendären Straßenbahnlinie 28. Hier eine
virtuelle Mitfahrt:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_YiHO5jZYY4&vq=medium#t=39
|
|
|
|
Unaufdringlich
elegant der Eingang des Rokoko-Baus, freundlich der Empfang bei
der Abholung der telefonisch vorbestellten Karten. Überhaupt
die Portugiesen: nette und höfliche Menschen ohne
südländische Zickigkeit und ohne lautes Wesen. Sie sind
eben Atlanter, keine Mediterraner. Ich mag die Portugiesen
besonders, seit in der unblutigen Nelkenrevolution von 1974 das
Militär die seit 1933 herrschende klerikal-faschistische
Diktatur stürzte. Nun war ich wieder mal dort, diesmal zum
»Hoffmann«.
|
|
|
|
Als
ich auf die Öffnung der Kasse wartete, stimmte mich eine
ebenfalls wartende portugiesische Opernfreundin auf die Oper ein:
sehr gutes Orchester, interessante Inszenierung und akzeptabler
Gesang in einem schönen Theater. Und so wurde es dann auch.
Das Opernhaus wurde im Rokoko in unaufdringlicher Eleganz
errichtet. Es ist nicht zu groß, und intelligent geplant,
so dass man auch von den Plätzen in den Rängen gut
sieht. Viel Gold im Inneren, die Ränge in kleine Logen
unterteilt, ein Mittelgang im Parkett, und keine übertriebene
Ornamentik oder gar Protz wie in Paris oder Wien. Nur die
Königsloge ist riesig und prunkvoll, beherbergte aber - ganz
republikanisch - keine Zuschauer.
|
|
|
|
Über
der Bühne eine Uhr. Das andere Theater, in dem ich einen
Zeitmesser sah, war die Semper-Oper in Dresden, wo eine
Digitaluhr mit lateinischen Ziffern über der Bühne
tickt. Wir saßen im Parkett in der ersten Reihe in der
Mitte, gleich hinter dem Dirigenten. Beste Plätze also.
|
|
|
|
Pünktlich
begann die Vorstellung im gut besetzten Theater. Gleich
beeindruckte mich das Portugiesische Symphonische Orchester mit
seinem präzisen und dynamischen Spiel. Einen Meter rechts
vor mir stand der Dirigent, direkt vor mir zuckte der Bogen des
Konzertmeisters auf und ab. So nah war ich noch nie am Ort des
Geschehens.
|
|
|
|
Zu
Beginn stellte sich ein Statist in weißer
unterwäscheähnlicher Kleidung in katatonischer Starre
an die Wand, mit dem Rücken zum Publikum. Links vorne stand
ein weißes Anstaltsbett, vorne in der Bühnenmitte ein
weißer Stuhl. Die Atmosfäre einer Irrenanstalt deutete
sich an. Naja, das hatte es ja schon mal in Lyon gegeben. Auf
einen Gazevorhang wurde das riesige Gesicht eines Mannes mit
wirren, langen schwarzen Haaren und einer Hornbrille projiziert.
Das war der Hoffmann.
|
|
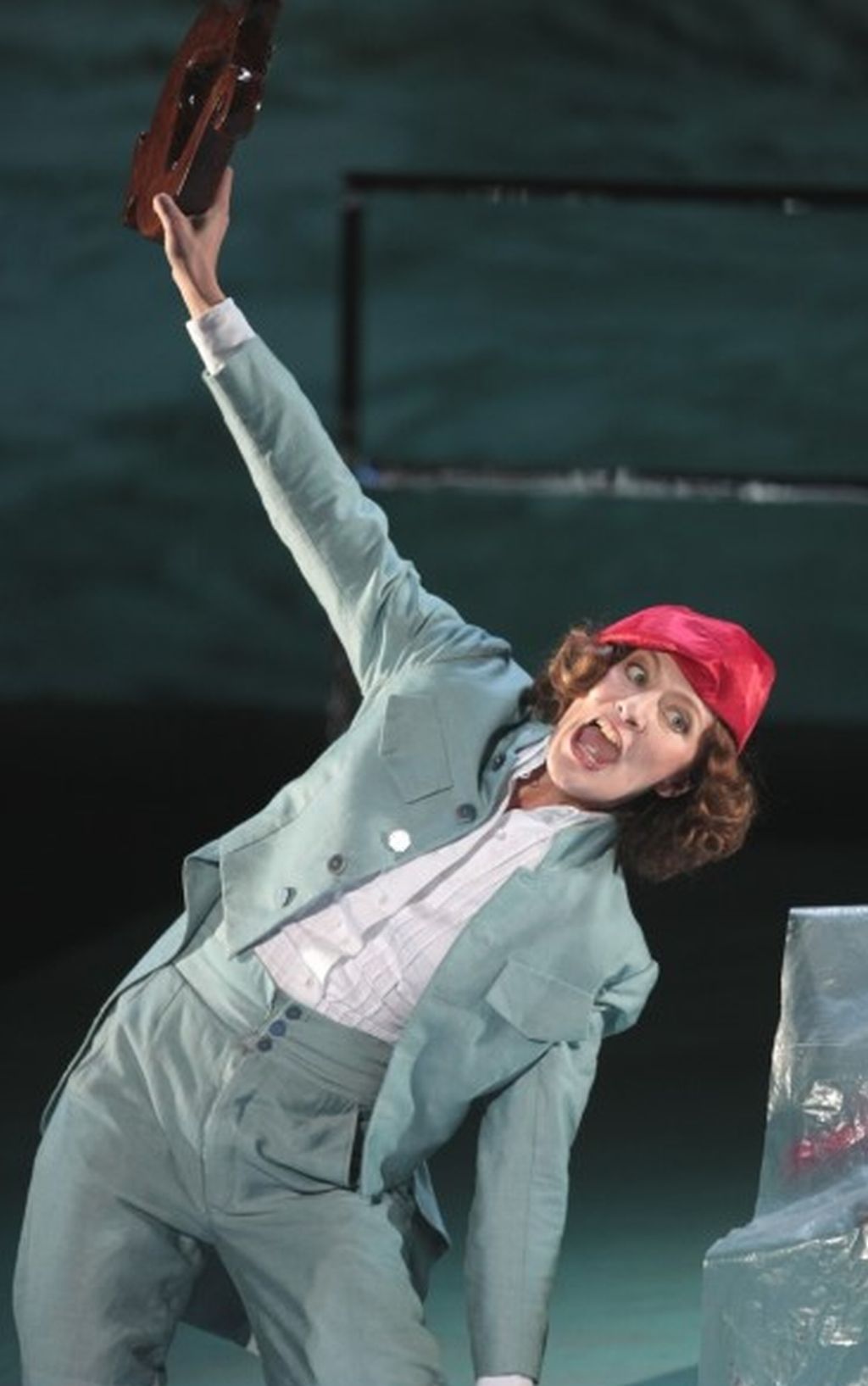
Muse
/ Niklaus
|
|
Der
Chor, lauter Männer, trat auf die Bühne. Ein anderer
Teil des Chores erklang von hinten aus der Königsloge. Die
Muse erschien in einem hellen Hosenanzug und setzte sich eine
rote Baskenmütze auf. Ihr androgynes Erscheinungsbild
erinnerte an Greta Garbo, noch mehr an Marlene Dietrich, der die
Darstellerin vom Typ her ähnelt. Sie überzeugte gleich
mit dynamischem Gesang und lebhaftem komödiantischem Spiel.
Niklaus hatte meistens einen Reisekoffer bei sich, aus dem er die
notwendigen Utensilien holte, zum Beispiel eine Harfe im
Olympia-Akt. Stella trat übrigens nicht persönllich
auf. Sie wurde nur auf einem Theaterplakat als „La divina
Stella" in der Rolle der Donna Anna im »Don Giovanni«
angekündigt.
|
|
|
Endlich
mischte sich Hoffmann unter seine Saufkumpane. Ein
existenzialistisch anmutender Dichter mit langen, zotteligen
Haaren und einer dicken Hornbrille. Jack Kerouac sah ja dagegen
viel gepflegter aus. Charles Bukowski kam dem Götz'schen
Hoffmann vom Aussehen her schon näher. Man merkte nicht,
dass der Franzose Jean-Pierre Furlan wegen Erkrankung des
regulären Hoffmann-Sängers Richard Bauer eingesprungen
war. Sänger pflegen ja solche Auftritte mit großer und
durchaus verständlicher Nervosität zu absolvieren.
Später erzählte er mir, dass er nur einen Tag zum
Proben gehabt und außerdem die Rolle seit 2005 nicht mehr
gesungen hatte. In einen »Hoffmann« einzuspringen ist
ja besonders problematisch, da diese Oper in jeder Inszenierung
eine andere Gestalt bekommt.
|
|
|
Lindorf
trat gar nicht seriös-ratsherrenhaft auf, sondern eher
provokant-frech; auch passend dazu das Kostüm. Unter den
Chorsängern war ein Charakter, der wie ein Doppelgänger
des Hoffmann zurecht gemacht war. Mit gleicher Perücke,
Brille und ähnlich gekleidet, schlich er um ihn herum.
Hoffmanns anderes, oder gespaltenes Ich?
|
|
|
Der
Olympia-Akt begann mit einer erläuternden Einleitung durch
eine Stimme aus einem Lautsprecher. Leider verstand ich nichts,
mangels portugiesischer Sprachkenntnisse. Gesungen wurde auf
Französisch mit portugiesischen Übertiteln. Das
Bühnenbild bestand wieder aus dem Krankenhausbett im
Vordergrund als Running Gag, dem weißen Stuhl in der
Bühnenmitte, sowie einem großen, auf den Hintergrund
projizierten Bild eines weißgekachelten Gewölbes, in
das eine Welle grünen Wassers hineinschwappte. Ich vermute,
man hatte dazu einen Tunnel der neugebauten Lissabonner U-Bahn
fotografiert.
|
|
|
|
Großartig
die Beleuchtung von Hans Toelstede, der oft mit Harry Kupfer
zusammenarbeitet. Ein heller Strahlenkranz, von der hinteren
Bühnenmitte ausgehend, war sein wichtigstes gestalterisches
Element. Die Regie verlegte diesen Akt in ein Irrenhaus voller
Patienten in weißer Anstaltskleidung. Auch der Psychiater
mit Arztkoffer fehlte nicht. Der Hoffmann kam in diese Umgebung
und schien seine eigene Diagnose samt Einweisung zur Kenntnis
nehmen zu müssen, denn er musste ein Dokument unterzeichnen.
Die Regie hatte sich viele Mühe gemacht, die Patienten nicht
als Einheitstypen aussehen zu lassen, denn jeder stellte ein
Individuum mit eigenen Posen und Bewegungen dar.
|
|
|
|
Olympia
wurde unter einer Plastikfolie hereingebracht, und Niklaus merkte
naürlich gleich, dass dieses Wesen unter der Folie kein
Mensch war. Coppélius kam mit Olympias Augen herein, die
er in je einem Plastikbeutel schwimmend brachte und dann
implantierte. Richtig gruselig. Mit ruckartigen Stößen
unter der Folie erwachte Olympia zum Leben und nahm ihre Rolle
auf. Gesteuert wurde sie von drei Helfern Spalanzanis, die heftig
an einem Apparat mit allerlei Hebeln, Skalen und Lichtern die
Energie für Olympia generierten. Die Festgäste bei
Spalanzani (Pedro Chaves), der selbst etwas blass blieb, waren im
Wesentlichen die Insassen des Irrenhauses, die nun Gazetücher
um die Augen gebunden hatten, einige schwarz, die meisten
hellblau.
|
|
|
|
Als
Olympia schwächelte, haute der Spalanzani ihr eine riesige
Spritze in das Hinterteil, und schon sang sie weiter. Beim
nächsten Mal bekam sie von ihrem Steuerungsapparat eine
Sauerstoffdusche. Die Götz'sche Olympia war kein verspieltes
Püppchen, sondern ein zielbewusst programmierter Automat,
der sein Programm konsequent abspulte. Hoffmann, durch die ihm
verpasste Brille geblendet, war eher das Opfer einer Intrige und
weniger der verliebte Galan. Die Olympia von Lissabon war eine
energisch vorgehende Maschine, die dem Hoffmann auf dem
Krankenhausbett zielbewusst auf den Leib rückte und ihm
dabei so kräftig die Hand drückte, dass er sie vor
Schmerz ausschütteln musste, nachdem er sich endlich etwas
Luft verschafft hatte. Olympia war, wie alle anderen
Frauenfiguren, mit einem schulterfreien Corsagenkleid gewandet.
Als seelenloser Automat hatte sie keinerlei Charme zu versprühen.
Auch ihr Gesang wirkte sehr energisch und automatenhaft.
|
|
|
|
Ich
fand diese Interpretation der Olympia interessant. So witzig und
puppenhaft oft die Olympia dargestellt wird, mit ihren
automatenhaften und ruckartigen Bewegungen, so verkörpert
eine solche Olympia meist einen echten Automaten nur teilweise,
denn ein Automat hat keine Seele, keinen Charme. Die Götz'sche
Olympia dagegen spulte zielbewusst und ohne große Schnörkel
die ihr einprogrammierte Rolle ab: den Hoffmann einzulullen und
gnadenlos zu täuschen. Unter diesem Aspekt fand ich
Christian von Götz' Olympia die werkgestreueste aller mir
bisher bekannten.
|
|
|
|
Die
Luzerner Olympia war großartig in Gesang und sprühend
als Verführerin, aber sie war alles andere als ein Automat.
Während des Olympia-Aktes rückten die weiß
gekleideten und geschminkten Chorsänger, teils Spalanzanis
Festgäste, teils Insassen einer Irrenanstalt, an die
Bühnenrampe und sangen direkt in die Gesichter des
Publikums. Eine beklemmende und intensive Nähe entstand.
Dann stürmte die Olympia hinaus, riss sich dabei die
strohblonde Perücke vom Kopf und zeigte einen kahlen Kopf.
|
|
|
|
Nach
dem Olympia-Akt war eigentlich keine Pause vorgesehen, aber
nachdem das Licht angegangen und der Dirigent den Orchestergraben
verlassen hatte, gingen wir in die stilvollen Säle hinaus.
Dort fiel mir auf, dass nicht allzu viele junge Leute im Publikum
waren.
|
|

Antonia
und Hoffmann
|
|
Der
Regisseur folgte mit der Reihenfolge der Akte der Mehrheit:
Antonia war Hoffmanns nächste Kandidatin. Das Bühnenbild
wurde von großen dunkelroten Strukturen eingerahmt, in der
Mitte stand ein Flügel. Antonia wurde von einer jungen
ukrainischen Sängerin dargestellt, die in Russland aufwuchs
und jetzt an der Stockholmer Oper stationiert ist. Maria Fontosh
war in ein rostbraunes Hauskleid gewandet, unter dem sie
allerdings ein schulterfreies Corsagenkleid trug, das ihre
Ambitionen als Opernsängerin andeutete. Ihr Kostüm war
gut durchdacht: äußerlich den Wünschen ihres
Vaters gehorchend, innerlich aber auf dem Sprung auf die Bühne,
die ihre Welt bedeuten. Maria Fontosh gab eine
dynamisch-eigensinnige Antonia und sang ganz hervorragend. Ihre
Antonia kann Karriere machen. Sinnlich-erotisch, stimmgewaltig
und souverän agierend deckte sie den eingesprungenen
Hoffmann mit ihrer Stimme zu.
|
|
|
Ganz
ausgezeichnet auch Dieter Schweikart als Krespel. Johannes von
Duisburg, der alle vier Bösewichter hervorragend sang, wuchs
in dieser Rolle über sich selbst hinaus. Als Doktor Mirakel
überzeugte er mit souveräner Diabolik. Hier war der
Regie ein Gag eingefallen: Mit Sonnenbrille im Gesicht und in
Ray-Charles-Pose setzte sich Doktor Mirakel an den Flügel
und trieb Antonia zum Gesang. Er tat das so heftig, dass
Rauchschwaden aus dem Flügel stiegen. Zu Mirakels Helferin
wurde Antonias Mutter, die mit teuflischer Süffisanz ihre
eigene Tochter in den tödlichen Gesang trieb. Die englische
Sprache hat dafür den Begriff „a pushing mother".
Antonia starb in den Armen ihres verzweifelten Vaters im Bett
links vorne, in dem viele wesentliche Ereignisse der Oper
stattfanden. Was ich nicht ganz verstand, war, dass Niklaus
während des Antonia-Aktes eine Melodie aus dem Schluss
vorwegnahm, mit der Niklaus die Apotheose einzuleiten pflegt.
|
|
|
|
Die
nächste Pause stand an, und ich hörte noch einige
deutsche Laute im Publikum. »Hoffmann«-Freunde aus
Wien und Dachau waren ebenfalls angereist. Wenn das der gute alte
Jacques Offenbach noch erfahren hätte, welches Geschenk er
seiner Nachwelt hinterließ und wie weit Opernfreunde wegen
seines Meisterwerkes reisen.
|
|
|
|
Am
Bühneneingang sprach ich mit ein paar Musikern, die ich zu
ihrer hervorragenden Leistung beglückwünschte. Ein
Violinist erzählte mir, dass die örtliche Theaterkritik
das Stück hatte durchfallen lassen. Das konnte ich überhaupt
nicht nachvollziehen. (Später im Jahr sprach ich in der
Covent-Garden-Oper mit einer französischen Kritikerin, die
am Lissabonner »Hoffmann« ebenfalls kaum ein gutes
Haar ließ, ohne dies näher zu begründen. Sie
meckerte übrigens auch an Covent Garden herum.)
|
|

Widersacher
|
|
Der
Giulietta-Akt begann vor einem gelungenen Bühnenbild. Der
Zuschauer blickte längs in einen venezianischen Kanal, vor
dem sich das Geschehen abspielte. Keine Gondel weit und breit.
Die Bühne füllte sich mit Besuchern des Bordells im
Frack und sehr hohen Zylindern. Sechs Tänzerinnen in roten
Gewändern bewegten sich zur Barcarole, aber ganz dezent.
Keine Laszivitäten hier am Tejo.
|
|
|
Die
Giulietta wurde von einer feurigen jungen Dame in einer schwarzen
Corsage mit Seidenrock darunter dargestellt, auch nicht weiter
erotisch. Sie sang eher verhalten, aber dafür mit lebhaftem
Spiel ihrer dunklen Augen. Das Gondellied hätte ich mir
etwas sahniger gewünscht, aber immerhin wurde es nicht von
einer krächzenden Jukebox abgenudelt wie in Warschau.
|
|
|
Ausführlich
wurde dargestellt, wie dem armen Hoffmann am Spieltisch sein Geld
abgenommen wird. Giulietta war eine eher harmlose Verführerin.
Schlemihl war ein geschniegelter Dandy, der von Hoffmann in einer
gut inszenierten Fechtszene erstochen wurde, als er sich schon
als Sieger wähnte. Erstaunlich, wie perfekt sich der
eingesprungene Hoffmann in so kurzer Probenzeit in das Ensemble
einfügte und noch dazu eine Fechtszene hinbrachte, wie man
sie heutzutage kaum mehr zu sehen bekommt.
Auf
dem Bett, wo sonst, klaute Giulietta dem Hoffmann sein
Spiegelbild, indem sie ihm einen Taschenspiegel vorhielt, in
welchem er sich nicht mehr sehen konnte. Dafür stand
Dapertutto triumphierend in einem Spiegelkabinett.
|
|
|
|
Der
Akt endete, wie er enden musste, mit der Rückkehr Hoffmanns
in die traurige Wirklichkeit. Ein Gazevorhang senkte sich herab,
und Niklaus stand alleine mit Hoffmann davor. Dann folgte eine
eindrucksvolle Szene, die ich so schnell nicht vergessen werde:
Hinter dem Gazevorhang standen dichtgedrängt Hoffmanns
Begleiter aus seinen drei Abenteuern. Stumm drückten sie
ihre Nasen und Handflächen an den Gazevorhang wie an eine
Glaswand und starrten den Hoffmann an, der nun wieder in der
Wirklichkeit angekommen war. Einfach großartig, diese
Bildsprache.
|
|
|
|
Die
Gestalten aus Hoffmanns Fantasiewelt verschwanden dann hinter
einer nüchternen grauen Wand, und Lindorf trat auf.
Gnadenlos riss er das Plakat mit Stella von der Wand und
zerfetzte es. Hoffmann lud eine Pistole durch und erschoss ihn.
Lindorf fiel, und rappelte sich nach kurzer Zeit grinsend wieder
auf. Hoffmann dagegen krümmte sich vor Schmerzen, fiel zu
Boden und hauchte sein Leben aus. Lindorf verschwand
triumphierend.
|
|
|
|
Zur
wunderschönen Musik der Apotheose hielt die Muse ein rotes
Buch, Hoffmanns Erzählungen darstellend, in die Höhe.
Ein ungewöhnlicher, aber interessanter Abschluss einer
gelungenen Inszenierung. Herzlicher Applaus des Publikums. Die
Sänger wurden gefeiert, besonders Antonia und natürlich
auch der ausgezeichnete Chor, der seinen Leiter (Rui Lopes Graca)
in die Mitte nahm. Sonderapplaus für das hervorragende
Orchester, das sich erhob, als der Dirigent Gregor Bühl auf
der Bühne stand. Das Publikum war gut mitgegangen während
der gesamten Vorstellung, war aber in seinem Applaus immer
portugiesisch verhalten. Am Schluss jedoch gab es zahlreiche
„brava-" und „bravo"-Rufe. Linguistisch
korrekt, denn wir befanden uns in einem romanischen Land.
|
|
|
|
Nach
der Vorstellung in diesem schönen Theater ging ich zum
Bühneneingang und holte mir Autogramme von Musikern und
Sängern. Vom Darsteller der Widersacher erfuhr ich auch die
Bedeutung der Schlussszene: Lindorf ist das andere Ich des
Hoffmann, und indem der versucht, dieses sein dunkles anderes Ich
zu töten, bringt er sich selbst um. Nicht uninteressant,
aber ohne Erklärung nicht sofort nachvollziehbar.
|
|
|
|
In
einem Lokal in der wunderschönen Altstadt von Lissabon
hatten sich einige Sänger und der Dirgent verabredet. Ich
holte mir noch die fehlenden Autogramme und führte
aufschlussreiche Gespräche über diese Inszenierung. Die
Konzertmeisterin, eine Bulgarin, erzählte mir, dass im
Symphonischen Orchester Portugals Musiker aus 18 Ländern
spielen. Unter den Sängern waren ja auch mehrere europäische
Nationen vertreten.
|
|
Die
Veröffentlichung der hier verwendeten Fotografien erfolgt
mit den ausdrücklichen Genehmigungen des Teatro Nacional
de São Carlos & des Fotografen Alfredo Rocha,
bei welchen sämtliche Rechte für die Nutzung der Bilder
liegen. Vielen Dank für die freundliche Kooperation!
|
|
|