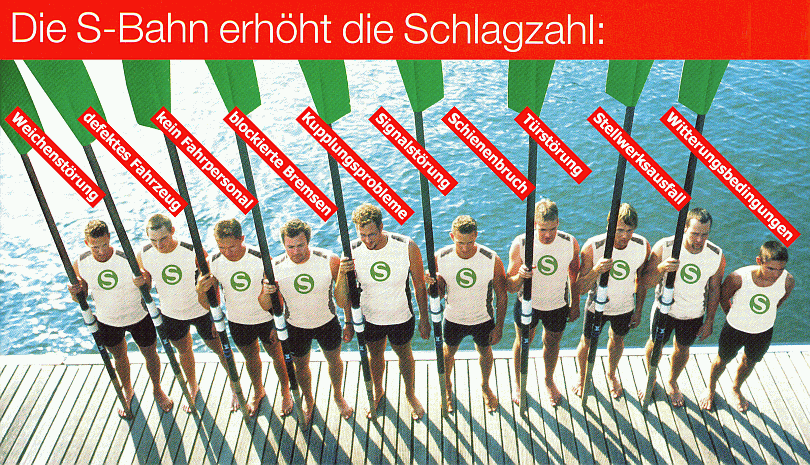S-Bahn München – die unendliche
Geschichte
Zur Münchner S-Bahn kann man fast jeden Monat etwas schreiben. Leider gibt es fast nie Positives zu berichten. Mit Sorge muss man dagegen beobachten, dass die negativen Tendenzen weiter zunehmen. Das gilt seit langem für Störungen; aktuell kommen Personalprobleme hinzu. Wenn die S-Bahn per Zeitungsartikel vorwarnt, nächstes Jahr noch mehr Züge ausfallen zu lassen (www.sz.de/muenchen/1.2695801), und wenn Staatsminister Herrmann mittels Pressemitteilung die DB deswegen öffentlich rügt (www.sz.de/muenchen/1.2702476), dann sind das sicher keine positiven Signale.
Wer an einem historischen Vergleich interessiert ist, kann in die PRO BAHN Post vom April 2005 schauen (www.pro-bahn.de/oberbayern/pbp/pbp0504.pdf) oder die damalige Bilanz inklusive Störfallliste durchlesen (www.pro-bahn.de/oberbayern/s-bahn/takt10). Ohne auf die Zahl der gemeldeten Störfälle einzugehen, die von vielerlei abhängt, wird man feststellen, dass sich zwar die verwendeten Begriffe geändert haben, es qualitativ aber keinen Fortschritt gibt.
Jetzt könnte man schließen: Die S-Bahn war schon immer schlecht, also gibt es keine Abwärtsspirale, sondern Stillstand auf niedrigem Niveau. Zum einem ist jedoch relativ klar, dass es vor zehn Jahren seltener Zugausfälle gab. Zum anderen gab es ja auch positive Schritte im S-Bahn-Bereich. Es wurden einige Strecken ausgebaut, es gab kleinere Verbesserungen an den Fahrzeugen und beim Abfertigungsverfahren. All das geht aber wegen gegenläufiger negativer Entwicklungen total unter; die resultierende Angebotsqualität wurde trotzdem schlechter.
Entscheidend ist noch etwas anderes: Der Raum München wächst quantitativ und qualitativ. Quantitativ heißt zunächst einmal Wachstum der Bevölkerung und auch der Verkehrslast. Daraus ergibt sich die Aufgabe, einen wachsenden Anteil dieser Verkehrslast zu übernehmen. Bei dieser Aufgabe versagt die S-Bahn, weil sie unzuverlässig ist und ihr Angebot zu wenig konkurrenzfähig ist.
Die Infrastruktur wurde nicht ausreichend angepasst, und wenn sie ausgebaut wurde, wurden die Bedürfnisse eines wachsenden Ballungsraums nicht richtig adressiert. So gibt es noch zu viele Abschnitte mit Mischverkehr und bei getrennten Gleisen zu wenige Verbindungen zwischen den Gleisgruppen für S-Bahnen und andere Züge. Überall fehlen im Störfall und bei Baustellen Wendemöglichkeiten. Sogar an der recht neuen Station Hirschgarten wurden Wendegleise vergessen, was sich bei Störungen auf der Stammstrecke fatal auswirkt. Ein so stark belastetes Bahnsystem müsste an jeder zweiten Station die Möglichkeit bieten, Züge zu wenden. Stattdessen gibt es weder ein Konzept noch die Absicht, das Netz in Richtung Robustheit zu entwickeln.
Qualitatives Wachstum bedeutet zum Beispiel, dass wir in einer High-Tech-Region leben, die Leute anzieht, die den Umgang mit komplexen technischen Sachverhalten gewöhnt sind. Das setzt dann Maßstäbe dafür, was sie in ihrem Lebensumfeld erwarten. Solche Erwartungen erfüllt die S-Bahn weder dem Anschein nach – man schaue nur die Bahnhöfe an – noch bei der Zuverlässigkeit oder bei der Information zu Störfällen.
Ganz ohne Zweifel gibt es im Raum München Menschen, die auf Öffentlichen Verkehr und auf die S-Bahn angewiesen sind. Es leben aber auch viele Leute hier, die sich Autos leisten können, die eben ein ganz anderes, zumindest optisch und technisch positiveres Erlebnis bieten. Und auch im Vergleich mit der U-Bahn, oder auch mit neuen Trambahnen und Bussen schneidet die S-Bahn so ab, dass sich die Kunden fragen, warum sie für das eine das gleiche zahlen sollen, wie für das andere.
Es seien noch einmal drei Fehler genannt, die nicht nur der DB zuzuordnen sind, sondern auch vielen Politikern – und das sogar parteiübergreifend:
- Der zweite S-Bahn-Tunnel wird offiziell als einziger Ausweg aus dem Dilemma
angesehen. Wenn man den Veröffentlichungen glaubt, löst er alle
genannten Probleme mit einem Schlag. Mit der Ausrede zweiter Tunnel werden
andere, notwendige Maßnahmen seit mehr als zehn Jahren verzögert oder
sind ganz von der Agenda verschwunden. Auch wenn dies in erster Linie durch eine
falsche Verkehrspolitik verursacht ist, muss man doch fragen, warum aus der
Praxis des Bahnbetriebs nicht mehr Widerstand gegen den unseligen Stillstand
kommt.
- Es werden, insbesondere durch die Störfallprogramme, immer wieder
dieselben Kundengruppen belastet. Bei Eingriffen in den Regelbetrieb ist es der
S-Bahn egal, ob es eine Strecke trifft, die sowieso schon stark problembehaftet
ist, oder eine der etwas besser laufenden Linien. Bei der DB gibt es keine
übergreifende Sicht auf diese Fragen, weil letztlich die Zufriedenheit der
Bahnkunden nur ein untergeordnetes Ziel des Konzerns ist. (*)
- Die DB – und darüber hinaus der ganze Sektor Öffentlicher Verkehr – geht traditionell nicht sehr transparent mit Problemen um. Das mag bei der S-Bahn München sogar etwas besser sein als in anderen Teilen des Konzerns, trotzdem wundert man sich immer wieder, wenn plötzlich etwas in der Zeitung steht, was sich eigentlich schon länger angebahnt haben muss. Natürlich ist es zunächst für den Kunden egal, ob die S-Bahn ausfällt, weil Personal fehlt, weil die Wartungskapazität nicht ausreichend ist, oder weil man so nach einem Störfall einfacher den Fahrplan auf der Stammstrecke hinbekommt. Das durch mangelnde Offenheit entstehende Misstrauen ist aber etwas, das zu schwerwiegenden und langfristigen Schäden im Verhältnis zwischen Kunden und Anbieter führt.
Wie sich die aktuelle Situation einschließlich der Ministerschelte auswirkt, wie es mittel- und langfristig auch in Bezug auf eine künftige Ausschreibung weitergeht, kann man wegen der oft irrationalen Verkehrspolitik nicht vorhersagen. Fest steht allerdings, dass die S-Bahn München aufgrund von Fahrgastzahlen und Verkehrsleistung einen großen Anteil an den Einnahmen der DB aus bestelltem Nahverkehr hat.
Edmund Lauterbach
(*) Zur Erläuterung von 2. hat die S-Bahn München beispielsweise am 5.11.2015 die Halte zwischen Laim und Hackerbrücke der S 1 ausfallen und sie am Hauptbahnhof enden lassen, weil es Probleme mit einem Stellwerk in Giesing gab. Nicht dass diese Linie irgendwie von dem Stellwerk betroffen wäre; es ist für die Verantwortlichen einfach bequem, sie aus der Stammstrecke herauszunehmen. Und im Tunnel fuhr die S 1 dann insgesamt vier Stunden lang nicht. Wenn man zusätzlich weiß, wie mühsam es sein kann, rechtzeitig an korrekte Informationen dazu zu kommen, wo man seine S-Bahn in einem solchen Fall findet, versteht man den Ärger der betroffenen Pendler.
Andere Texte zur S-Bahn:
- S-Bahn in der Abwärtsspirale?
(Juli 2015)
- Mein S-Bahn-Jahr 2014
(Februar 2015)
- S-Bahn München, quo vadis?
(Mai 2014)
Und so sah es 2005 aus: